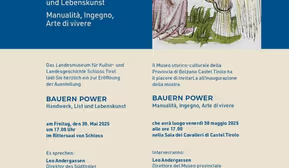Andrea Facco "Anamnesis Pcitoria" Solo Show
BESCHREIBUNG
Das Werk von Andrea Facco bewegt sich seit jeher auf dem schmalen
Grat zwischen Malerei und Metamalerei, zwischen technischer Präzision
und philosophischer Reflexion über den Sinn des Malens selbst.
In Anamnesis Pictoria präsentiert der Künstler zwei jüngere und innerlich eng miteinander verwobene Werkserien: die Tavolozze und die Ghost Paintings.
Die Tavolozze sind Flächen, auf denen die Farbe zugleich explodiert und sich absetzt – vitale Rückstände eines alltäglichen Tuns, das die gesamte Dichte und Materialität des malerischen Prozesses in sich trägt. Jede Palette bewahrt die Erinnerung an die Geste und an die Zeit der Entstehung eines Werkes. Sie absorbiert Farbtöne, die keinem abgeschlossenen Bild mehr angehören, sondern dessen materischen Schatten bilden – die Bedingung seiner Möglichkeit. Es sind Spuren, Abdrucke, energetische Felder, in denen die Farbe zum autonomen Subjekt wird, befreit von jeder Verpflichtung zur Darstellung. Aus diesen Ablagerungen entsteht die sogenannte Graufarbe, das durch das Ausspülen der Pinsel im Wasser während der Arbeit an den Gemälden gewonnen wird. Mit dieser scheinbar neutralen, residualen Substanz schafft Facco die Ghost Paintings: Reproduktionen verlorener, zerstörter, geraubter oder dem Blick für immer entzogener Werke. Von Morandi bis Caravaggio, von Raffael bis Klimt, setzt sich die Serie mit einem unwiederbringlich entwendeten ikonischen Erbe auseinander und ruft dessen geisterhafte Präsenz hervor.
Die Leinwände, im Maßstab eins zu eins zu den Originalen ausgeführt, erscheinen als graue Visionen, schwebend zwischen Hommage und Unmöglichkeit, zwischen Erinnerung und Verlust. Der Dialog zwischen den beiden Serien ist wesentlich: Während die Tavolozze die Lebendigkeit und Präsenz der Farbe bewahren, offenbaren die Ghost Paintings deren Abwesenheit. So verwandelt sich die Malerei in eine metaphysische Schwelle zwischen dem, was existiert, und dem, was nicht mehr ist. Die aus Resten regenerierte Farbsubstanz wird zum Medium einer radikalen Reflexion: Malerei nicht nur als Bild, sondern als verkörpertes Denken, als kritisches Gedächtnis, als Übung der Wiederaneignung. In dieser doppelten Spannung – zwischen Fülle und Mangel, zwischen Präsenz und Phantom – bekräftigt Andrea Facco die zentrale Bedeutung der Malerei als Form der Erkenntnis und als Akt des Widerstands.
Uhrzeit
VERANSTALTUNGSORT
Kapuzinergasse 26a , 39100 Bozen
BESCHREIBUNG
Das Werk von Andrea Facco bewegt sich seit jeher auf dem schmalen
Grat zwischen Malerei und Metamalerei, zwischen technischer Präzision
und philosophischer Reflexion über den Sinn des Malens selbst.
In Anamnesis Pictoria präsentiert der Künstler zwei jüngere und innerlich eng miteinander verwobene Werkserien: die Tavolozze und die Ghost Paintings.
Die Tavolozze sind Flächen, auf denen die Farbe zugleich explodiert und sich absetzt – vitale Rückstände eines alltäglichen Tuns, das die gesamte Dichte und Materialität des malerischen Prozesses in sich trägt. Jede Palette bewahrt die Erinnerung an die Geste und an die Zeit der Entstehung eines Werkes. Sie absorbiert Farbtöne, die keinem abgeschlossenen Bild mehr angehören, sondern dessen materischen Schatten bilden – die Bedingung seiner Möglichkeit. Es sind Spuren, Abdrucke, energetische Felder, in denen die Farbe zum autonomen Subjekt wird, befreit von jeder Verpflichtung zur Darstellung. Aus diesen Ablagerungen entsteht die sogenannte Graufarbe, das durch das Ausspülen der Pinsel im Wasser während der Arbeit an den Gemälden gewonnen wird. Mit dieser scheinbar neutralen, residualen Substanz schafft Facco die Ghost Paintings: Reproduktionen verlorener, zerstörter, geraubter oder dem Blick für immer entzogener Werke. Von Morandi bis Caravaggio, von Raffael bis Klimt, setzt sich die Serie mit einem unwiederbringlich entwendeten ikonischen Erbe auseinander und ruft dessen geisterhafte Präsenz hervor.
Die Leinwände, im Maßstab eins zu eins zu den Originalen ausgeführt, erscheinen als graue Visionen, schwebend zwischen Hommage und Unmöglichkeit, zwischen Erinnerung und Verlust. Der Dialog zwischen den beiden Serien ist wesentlich: Während die Tavolozze die Lebendigkeit und Präsenz der Farbe bewahren, offenbaren die Ghost Paintings deren Abwesenheit. So verwandelt sich die Malerei in eine metaphysische Schwelle zwischen dem, was existiert, und dem, was nicht mehr ist. Die aus Resten regenerierte Farbsubstanz wird zum Medium einer radikalen Reflexion: Malerei nicht nur als Bild, sondern als verkörpertes Denken, als kritisches Gedächtnis, als Übung der Wiederaneignung. In dieser doppelten Spannung – zwischen Fülle und Mangel, zwischen Präsenz und Phantom – bekräftigt Andrea Facco die zentrale Bedeutung der Malerei als Form der Erkenntnis und als Akt des Widerstands.